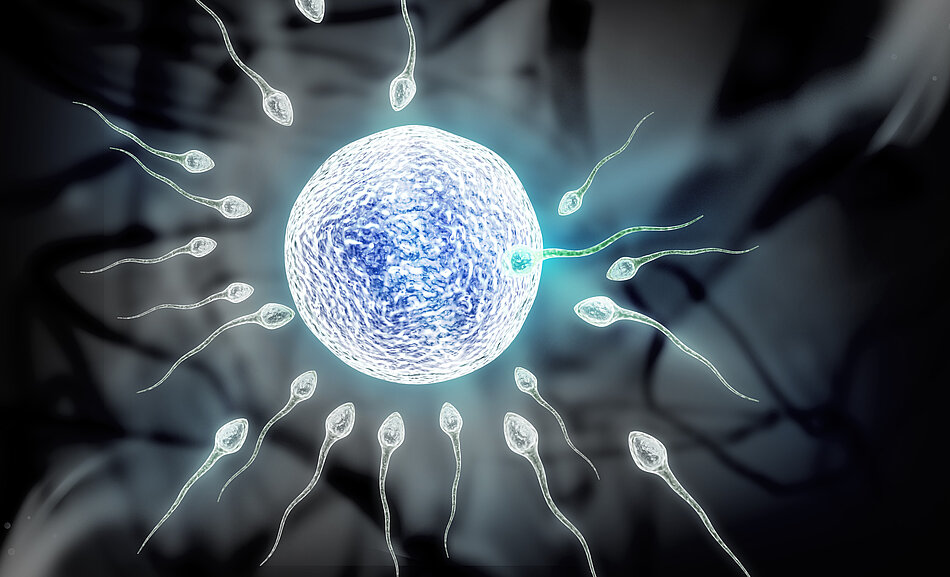Schwangerschaftsabbruch, Eizellspende, Leihmutterschaft: Die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin hat in ihrem Abschlussbericht empfohlen, Frauen in den ersten zwölf Wochen ein Recht auf Abtreibung einzuräumen und die Eizellspende unter engen Voraussetzungen zu erlauben. Die altruistische Leihmutterschaft solle hingegen verboten bleiben.
Der Deutsche Ärztetag will sich im nächsten Jahr in Leipzig in einem eigenen Tagesordnungspunkt mit einer möglichen Liberalisierung des Abtreibungsrechts befassen.
von Heike Korzilius
Was wiegt mehr? Das Selbstbestimmungsrecht der Frau oder das Lebensrecht ihres ungeborenen Kindes? Gibt es ein Recht auf ein Kind und damit das Recht, sämtliche reproduktionsmedizinischen Möglichkeiten auszuschöpfen? Die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin hat ein gutes Jahr lang im Auftrag der Bundesregierung die Möglichkeiten geprüft, den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches zu regeln sowie die Eizellspende und die altruistische Leihmutterschaft zu legalisieren.
Zurzeit regelt § 218, dass eine Abtreibung zwar rechtswidrig ist, aber straffrei bleibt, wenn sie innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen und nach einem verpflichtenden Gespräch in einer anerkannten Beratungsstelle stattfindet. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1993. Das Gericht hatte damals entschieden, dass das grundsätzliche Verbot eines Schwangerschaftsabbruchs bestehen bleiben müsse, da das Grundgesetz den Staat verpflichte, menschliches Leben zu schützen. Dazu zähle auch das Leben des Ungeborenen. Es hatte aber eingeräumt, dass eine Abtreibung unter bestimmten Bedingungen straffrei bleiben kann.
Abgestufter Lebensschutz
Mit ihrer Empfehlung, Frauen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ein Recht auf Abtreibung einzuräumen, kündigt die Kommission diesen nach hoch kontroversen gesellschaftlichen Debatten in Gesetzesform gegossenen Kompromiss auf. Die Juristinnen der Arbeitsgruppe argumentieren mit einer Art abgestuftem Lebensschutz. Je kürzer die Schwangerschaft bestehe, desto eher sei ein Abbruch zulässig, und je fortgeschrittener das Gestationsalter sei, desto gewichtiger seien die Belange des Ungeborenen, heißt es im Kommissionbericht. Für Schwangerschaftsabbrüche bis zur 22. Woche, ab der von einer Lebensfähigkeit des Fötus außerhalb des Mutterleibs ausgegangen wird, verweist die Kommission auf den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers. Bei einem möglichen Verbot, müssten aber Ausnahmen insbesondere für die medizinische oder kriminologische Indikation vorgesehen werden. Das gelte auch für die Spätphase der Schwangerschaft, in der der Gesetzgeber den Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich nicht mehr erlauben sollte.
Die Reaktionen auf die Empfehlungen fielen bei den Auftraggebern eher verhalten aus. Bundesgesundheitsminister Professor Dr. Karl Lauterbach dankte der Kommission für „die Anregungen zur Debatte“. Bundesjustizminister Marco Buschmann erklärte, die Bundesregierung werde den Bericht gründlich auswerten, und Bundesfamilienministerin Lisa Paus bekräftigte, der Abschlussbericht der Kommission biete „eine gute Grundlage für den nun notwendigen offenen und faktenbasierten Diskurs“. Denn diesen brauche es bei den Themen Schwangerschaftsabbruch und unerfüllter Kinderwunsch. „Wir alle wissen, wie emotional diese sein können“, so Paus. Quer durch die Parteien ist die Furcht vor einer gesellschaftlichen Polarisierung groß.
Das spiegelte auch die Diskussion auf dem 128. Deutschen Ärztetag im Mai in Mainz. Dem Ärzteparlament lagen fünf Anträge zum Schwangerschaftsabbruch zur Beschlussfassung vor. Sie reichten von der Forderung, die Liberalisierung von Abtreibungen im ersten Trimenon noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen, bis hin zum „vehementen“ Widerstand gegen eine Änderung des geltenden § 218. Entlang dieser Linien entspann sich eine kontroverse Debatte, bei der einige Abgeordnete angesichts der Emotionalität und Komplexität des Themas ihre Überforderung signalisierten. Sie fühle sich nicht richtig vorbereitet, hier weitreichende Beschlüsse zu treffen, die Folgen für die gesamte Gesellschaft hätten, erklärte Dr. Nadezda Jesswein, Niedersachsen. Die Abgeordneten votierten schließlich für den Antrag einiger nordrheinischer Delegierter, beim 129. Deutschen Ärztetag im nächsten Jahr in Leipzig die Liberalisierung des Abtreibungsrechts in einem eigenen Tagesordnungspunkt zu diskutieren. Dr. Lydia Berendes, eine der Antragstellerinnen, hatte zuvor betont: „Viele hier sind bei dem Thema ambivalent. Wir sind nicht nur medizinisch gefragt, sondern auch ethisch-moralisch.“ Die Kommission habe in erster Linie zur Selbstbestimmung gesprochen. „Ich als Mutter einer behinderten Tochter setze mich ein für das ungeborene Leben. Das fehlt mir im Kommissionbericht“, so Berendes. Dr. Susanne Johna, Hessen, erklärte: „Wir müssen uns für das ungeborene Leben einsetzen, aber wir müssen uns auch für das geborene Leben engagieren.“ Deshalb sei sie sehr für die Beibehaltung einer Beratungspflicht. „Aber der Schwangerschaftsabbruch muss aus dem Strafgesetzbuch raus“, forderte Johna. „Sollte dies tatsächlich umgesetzt werden, müssen wir klären, wie wir den Schutz des ungeborenen Lebens gewährleisten“, mahnte Rudolf Henke, Präsident der Ärztekammer Nordrhein. „Wir müssen Alternativen bieten und das wird eine gesellschaftliche Debatte brauchen“, so Henke. Denn der Staat müsse nach dem Grundgesetz jedes Leben schützen.
Für weniger Aufsehen in Politik und Öffentlichkeit sorgten die Empfehlungen der Regierungskommission zur Eizellspende und zur altruistischen Leihmutterschaft. Eine Legalisierung der Eizellspende hält sie für zulässig, wenn der Schutz der Spenderinnen und das Kindeswohl gesetzlich verankert werden. Der Gesetzgeber habe 1990 das Verbot der Eizellspende damit begründet, eine „gespaltene Mutterschaft“ vermeiden zu wollen, die das Kindeswohl gefährden könnte. Aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht gelte das inzwischen als überholt und nicht mehr überzeugend.
Deutlich zurückhaltender fallen die Empfehlungen der Regierungskommission zur Leihmutterschaft aus. Diese berge selbst in altruistisch angelegten Modellen Potenzial für Missbrauch, heißt es im Bericht. Die Kommission empfiehlt deshalb, am bisherigen Verbot festzuhalten. Sollte die Leihmutterschaft dennoch erlaubt werden, dann nur in den Fällen, in denen – analog zur Lebendorganspende – ein engeres freundschaftliches oder verwandtschaftliches Verhältnis zwischen Leihmutter und Wunscheltern besteht.
Zurzeit prüft die Bundesregierung die Empfehlungen der Regierungskommission. Zu Details und gegebenenfalls gesetzlichen Änderungsbedarfen könne man noch keine Stellung nehmen, erklärte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage.